lingvo.wikisort.org - Forscher
Erich Fried (* 6. Mai 1921 in Wien; † 22. November 1988 in Baden-Baden) war ein österreichischer Lyriker, Übersetzer und Essayist, der ab 1938 in London im Exil lebte.

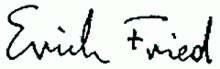
Fried ist ein Hauptvertreter der politischen Lyrik deutscher Sprache in der Nachkriegszeit, der T. S. Eliot, Dylan Thomas, Graham Greene, Sylvia Plath, John Synge und andere übersetzte und nach Ludwig Tieck wieder William Shakespeare in lebendiger Sprache ins Deutsche übertrug.[1] Er schrieb auch einen Roman und Kurzprosa. Mit Elias Canetti, Franz Baermann-Steiner, H. G. Adler, Grete Fischer, Gabriele Tergit und Wilhelm Unger zählte er zum Kreis deutschsprachiger Exilautoren in London und war mit der Übersetzerin Carla Wartenberg befreundet.
Er beteiligte sich am politischen Diskurs seiner Zeit, hielt Vorträge, nahm an Demonstrationen teil und war mit Rudi Dutschke[2] und Gretchen Dutschke-Klotz befreundet, die wie Hans Magnus Enzensberger, Fritz Teufel und andere Vertreter der Außerparlamentarischen Opposition seine Gäste in London waren.[3] Mit seinen 1979 veröffentlichten Liebesgedichten fand er ein breiteres Publikum.
Leben
Erich Fried wuchs in Wien als einziges Kind einer jüdischen Familie auf. Sein Vater Hugo war Spediteur und seine Mutter Nellie Grafikerin. Bereits als Fünfjähriger trat er mit einer Kinderschauspielgruppe auf verschiedenen Bühnen Wiens auf. Fried besuchte das Gymnasium Wasagasse im Alsergrund. Bald nach dem „Anschluss“ Österreichs an Deutschland starb im Mai 1938 Frieds Vater an den Folgen der Folter bei einem Verhör durch die Gestapo. Daraufhin emigrierte Erich Fried über Belgien nach London, wo er bis zu seinem Tod wohnte. Er gründete dort die Selbsthilfegruppe Emigrantenjugend, der es gelang, viele Gefährdete, darunter auch seine Mutter, nach England zu bringen. In London gehörte er dem Freien Deutschen Kulturbund, der Jugendorganisation Young Austria und dem Kommunistischen Jugendverband Österreichs an, aus dem er 1943 wegen zunehmender stalinistischer Tendenzen wieder austrat. Während des Kriegs bestritt er sein Leben mit Gelegenheitsarbeiten als Bibliothekar, Milchchemiker, Fabrikarbeiter, wurde nach 1945 Mitarbeiter neu gegründeter Zeitschriften und arbeitete von 1952 bis 1968 als politischer Kommentator für den German Service der BBC, deren kritische Haltung zur DDR dazu führte, dass Fried bis Ende der 1980er Jahre dort Einreise- und Auftrittsverbote bekam. 1944 veröffentlichte er seinen ersten Gedichtband, die antifaschistische Lyriksammlung Deutschland, im Exilverlag des österreichischen PEN-Clubs. Von 1947 bildete Fried um Franz Baermann Steiner bis zu dessen Tod 1952 zusammen mit H. G. Adler, Hans Eichner, Hans Werner Cohn und Tuvia Rübner die Londoner Gruppe 47 deutschsprachiger Dichter im Exil.[4] 1949 wurde er britischer und zusätzlich 1982 wieder österreichischer Staatsbürger. 1962 besuchte Erich Fried erstmals nach seiner Flucht wieder offiziell Wien und wurde 1963 Mitglied der Gruppe 47.
Aufgrund der Anerkennung und des großen Erfolgs insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland gab Fried seine Arbeit bei der BBC 1968 auf und lebte bis zu seinem Lebensende als freier Schriftsteller. Auf ausgedehnten Auslandsreisen trug er seine Gedichte auf großen politischen Veranstaltungen vor, häufig im Rahmen der 68er-Bewegung. Seine politische Lyrik beeindruckte und war umstritten. Zum einen war er der geehrte Dichter, der 1977 einen Lehrauftrag an der Universität Gießen erhielt, zum anderen der scharfe öffentliche Kritiker politischer Zustände, der wegen seiner Aussagen verklagt wurde. Der West-Berliner Polizeipräsident Klaus Hübner zeigte Fried wegen Beleidigung an, weil dieser in seinem Leserbrief im Spiegel vom 7. Februar 1972 die Erschießung Georg von Rauchs durch einen Polizeibeamten „Vorbeugemord“ genannt hatte. Vor dem Amtsgericht Hamburg, bei dem Heinrich Böll als Gutachter aussagte, wurde Fried am 24. Januar 1974 freigesprochen. Auch geriet er in die Kritik, weil er sich in den 1970er-Jahren nicht an der „Sympathisanten-Hetze“ gegen Personen im vermuteten Umfeld der Baader-Meinhof-Gruppe beteiligte.[5][6] Frieds Gedichtbände fanden auch in den 1970er Jahren ein breites Publikum, sie begleiteten die Entwicklung linker, alternativer Bewegungen in der BRD, teilweise durchaus kritisch. Er unterstützte die Friedensbewegung und begrüßte die Perestroika Gorbatschows.
Nach 1979 und seinem sehr erfolgreichen Lyrikband Liebesgedichte veröffentlichte Fried weitere Gedichtbände über Liebe, Leben, Hoffnungen und Tod, mit Gedichten wie beispielsweise Was es ist oder Als ich mich nach dir verzehrte. Ende 1984 besuchte er auf eigenen Wunsch Michael Kühnen, den Führer der „Aktionsfront Nationaler Sozialisten“, im Gefängnis, weil er dessen Auffassungen nicht teilte und ihn eines Besseren belehren wollte. Der nachgelassene Briefwechsel zeigt, wie Fried mit seinem Bemühen scheiterte.[7][8][9][10]

Erich Fried starb am 22. November 1988[11] in Baden-Baden an einem Darmkarzinom. Das Grab befindet sich auf dem Londoner Friedhof Kensal Green. Frieds Nachlass wird im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt.
Privates
1944 heiratete er Maria Marburg kurz vor der Geburt seines Sohnes Hans. 1946 trennte er sich von Maria. Die Scheidung erfolgte 1952. Im selben Jahr heiratete er Nan Spence-Eichner, mit der er zwei Kinder, Sohn David (* 1958) und Tochter Katherine (* 1961), hatte. Nan verließ Erich Fried 1962, die Ehe wurde 1965 geschieden. Im Sommer 1965 heiratete er Catherine Boswell. Im Herbst kam ihre gemeinsame Tochter Petra zur Welt, 1969 die Zwillinge Tom und Klaus. Letzterer ist als Regisseur und Produzent tätig und unterrichtet am London College of Communication.[12][13]
Auszeichnungen
- 1972 Österreichischer Würdigungspreis für Literatur
- 1977 Internationaler Verlegerpreis der Sieben (Prix International des Editeurs)
- 1980 Literaturpreis der Stadt Wien
- 1983 Literaturpreis der Stadt Bremen
- 1985 Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
- 1986 Österreichischer Staatspreis für Verdienste um die österreichische Kultur im Ausland
- 1986 Carl-von-Ossietzky-Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte
- 1987 Goldener Schlüssel der Stadt Smederevo (Jugoslawien)
- 1987 Georg-Büchner-Preis
- 1988 Ehrendoktorwürde der Universität Osnabrück (Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft)
Wirkung
1989 wurde in Wien die Internationale Erich Fried Gesellschaft für Literatur und Sprache gegründet, welche seit 1990 den Erich-Fried-Preis verleiht, der hochdotiert vom österreichischen Bundeskanzleramt gestiftet wird. Anlässlich seines 20. Todestages fanden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt, an denen auch Catherine Boswell Fried mit einer Lesung aus ihrem 2008 erschienenen Buch über die gemeinsamen Jahre in London beteiligt war, so in Wien, Berlin, Freiburg, Aachen, Recklinghausen, Bad Boll und London.[14] Im Jahr 2013 wurde in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) der Erich-Fried-Weg nach ihm benannt. Auch Schulen in Deutschland und Österreich tragen seinen Namen.[15] Seine Werke wurden weltweit übersetzt, nicht nur ins Englische, Französische, Bulgarische und Russische, sondern auch ins Chinesische und Vietnamesische. Es existiert zudem eine Übertragung ins Plattdeutsche.
Werke




- Blutiger Freitag, 1929 (als Neunjähriger gegen den Polizeieinsatz beim Wiener Justizpalastbrand/Julirevolte)
- Judas Weg, ca. 1943 (Gedicht aus dem Nachlass: Jesus von Nazareth als Antipode zur Moses-Figur)
- Deutschland, 1944.
- Österreich, 1945.
- Drei Gebete aus London, 1945 (Gedicht).
- Nacht in London, 1946 (Gedicht).
- Gedichte, 1958.
- Ein Soldat und ein Mädchen, 1946/1960[16] (sein einziger Roman[17])
- Izanagi und Izanami, 1960 (Hörspiel)
- Die Expedition, 1962.
- Reich der Steine, 1963.
- Warngedichte, 1964.
- Überlegungen, 1964.
- Kinder und Narren, 1965 (Novellen)
- und Vietnam und, 1966.
- Indizienbeweise, 1966 (Hörspiel)
- Anfechtungen, 1967.
- Zeitfragen, 1968.
- Befreiung von der Flucht, 1968.
- Die Beine der größeren Lügen, 1969.
- Unter Nebenfeinden, 1970.
- Die Freiheit den Mund aufzumachen, 1972.
- Neue Naturdichtung, 1972.
- Höre, Israel, 1974 (scharfe Kritik an Israel und am Zionismus)
- Gegengift, 1974.
- Fast alles Mögliche. Wahre Geschichten und gültige Lügen, 1975.
- Die bunten Getüme, 1977.
- So kam ich unter die Deutschen, 1977.
- Die Anfrage, 1977.
- 100 Gedichte ohne Vaterland, 1978.
- Liebesgedichte, 1979.
- Lebensschatten, 1981.
- Zur Zeit und zur Unzeit, 1981
- Das Nahe suchen, 1982.
- Das Unmaß der Dinge, 1982 (Prosa)
- Es ist was es ist, 1983 (darin sein vermutlich bekanntestes Werk Was es ist)
- Angst und Trost. Erzählungen und Gedichte über Juden und Nazis, 1983.
- Beunruhigungen, 1984.
- ...und alle seine Mörder... .Ein Schauspiel, 1984
- Um Klarheit, 1985.
- Von Bis nach Seit, 1985.
- Mitunter sogar Lachen, 1986 (Erinnerungen)
- Am Rand unserer Lebenszeit, 1987.
- Unverwundenes, 1988.
- Einbruch der Wirklichkeit Verstreute Gedichte 1927–1988, 1991.
- Ausgaben
- Gesammelte Werke in vier Bänden, Berlin 1993.
- Anfragen und Nachreden, Politische Texte, Wagenbach Verlag, Berlin 1994, ISBN 978-3-8031-2231-5
- Die Muse hat Kanten, Aufsätze und Reden zur Literatur, Wagenbach Verlag, Berlin 1995, ISBN 978-3-8031-2246-9
- Höre Israel, Gedichte und Fußnoten, Gedichte gegen das Unrecht, Melzer-Verlag, Neu-Isenburg 2010, ISBN 978-3942472012
- Freiheit herrscht nicht, Gespräche und Interviews, Wagenbach, Berlin (April) 2021, ISBN 978-3-8031-2839-3
Hörspiele
Als Autor:
- 1960: Izanagi und Izanami – Regie: Egon Monk (NDR)
- Sprecher u. a.: Sebastian Fischer, Solveig Thomas und Armas Sten Fühler
- 1962: Die Expedition – Regie: Fritz Schröder-Jahn (NDR)
- Sprecher u. a.: Wolfgang Wahl, Maria Körber und Gerd Baltus
- 1966: Indizienbeweise – Regie: Fritz Schröder-Jahn (NDR)
- Sprecher u. a.: Eva Katharina Schultz, Uwe Friedrichsen und Max Eckard
- 1967: Izanagi und Izanami – Regie: Erwin Zbonek (ORF)
- Sprecher: Nicht angegeben
- 1980: Welch Licht scheint dort? – Weihnachtsszenen aus den Yorker Mysterien – Regie: Urs Helmensdorfer (DRS)
- Sprecher: Nicht angegeben
Als Bearbeiter (Wort) und/oder Übersetzer:
- 1954: Dylan Thomas: Unter dem Milchwald – Regie: Fritz Schröder-Jahn (Bearbeiter/Übersetzer)
- 1956: Dylan Thomas: Die Rückreise – Regie: Gert Westphal (Übersetzer)
- 1957: Dylan Thomas: Rückreise – Regie: Hermann Brix (Übersetzer)
- 1958: Dylan Thomas: Die Rückreise – Regie: Fritz Schröder-Jahn (Bearbeiter/Übersetzer)
- 1958: Dylan Thomas: Erinnerung an einen Feiertag – Regie: Fritz Schröder-Jahn (Übersetzer)
- 1958: John Millington Synge: Kesselflickers Hochzeit – Regie: Kurt Reiss (Bearbeiter/Übersetzer)
- 1959: Dylan Thomas: Der Doktor und die Teufel (2 Teile) – Regie: Fritz Schröder-Jahn (Übersetzer)
- 1960: Richard Wright: Mädchen für alles – Regie: Gustav Burmester (Übersetzer)
- 1960: Thomas Stearns Eliot: Ein verdienter Staatsmann – Regie: Oscar Fritz Schuh (Übersetzer)
- 1960: Dylan Thomas: Richtige Weihnachten – Regie: Fritz Schröder-Jahn (Bearbeiter/Übersetzer)
- 1961: Laurie Lee: Requiem für einen großen Kapitän – Regie: Joachim Hoene (Übersetzer)
- 1961: Thomas Stearns Eliot: Ein verdienter Staatsmann – Bearbeitung und Regie: Hans Conrad Fischer (Übersetzer)
- 1961: Thomas Stearns Eliot: Ein verdienter Staatsmann – Regie: Wolfgang Spier (Übersetzer)
- 1962: Richard Hughes: Gefahr – Regie: Fritz Schröder-Jahn (Übersetzer)
- 1962: Johann Nestroy: Der gutmütige Teufel oder: Die Geschichte vom Bauern und der Bäuerin – Regie: John Olden (Bearbeiter)
- 1963: Dylan Thomas: Die Funkerzählung: Die Nachgänger – Regie: Cläre Schimmel (Übersetzer)
- 1965: Dylan Thomas: Weihnachtserinnerungen – Bearbeitung und Regie: Oswald Döpke (Übersetzer)
- 1968: Barry Bermange: Hörspiel in der Diskussion: Oldenberg – Regie: Donald McWhinnie (Übersetzer)
- 1969: Dylan Thomas: Unter dem Milchwald. Ein Spiel für Stimmen – Regie: Raoul Wolfgang Schnell (Übersetzer)
- 1969: Gaston Bart-Williams: Uhuru – Regie: Hein Bruehl (Übersetzer)
- 1970: Dylan Thomas: Rückreise – Regie: Robert Bichler (Übersetzer)
- 1970: Barry Bermange: Oldenberg – Regie: Werner Grunow (Übersetzer)
- 1974: Barry Bermange: Knochen – Regie: Heinz Dieter Köhler (Übersetzer)
- 1976: Barry Bermange: Fürsorge – Regie: Friedhelm Ortmann (Übersetzer)
- 1978: Dylan Thomas: Rückreise – Regie: Willi Schmidt (Übersetzer)
- 1980: Richard Farber: Die Höhle. Ein Autodrama für den Funk – Regie: Richard Farber (Übersetzer)
- 1986: Richard Hughes: Gefahr – Regie: Bärbel Jarchow-Frey (Übersetzer)
- 1989: Shakespeare. 27 Stücke von William Shakespeare (Übersetzer)
- 1990: Dylan Thomas: Unter dem Milchwald – Regie: Fritz Göhler (Übersetzer)
- 1992: Dylan Thomas: Weihnachtsgespräch – Regie: Raoul Wolfgang Schnell (Übersetzer)
- 1992: Dylan Thomas: Weihnachtsgespräch – Bearbeitung und Regie: Joachim Staritz (Übersetzer)
- 2003: Dylan Thomas: Unter dem Milchwald – Bearbeitung und Regie: Götz Fritsch (Übersetzer)
Literatur
- M. Zeller, Gedichte haben Zeit. Aufriss einer zeitgenössischen Poetik. Stuttgart 1982.
- Erich Fried. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold. 2. Auflage. München 1997 (EV 1986), ISBN 3-88377-223-2.
- Erich Fried. In: Jüdische Portraits. hrsg. von H. Koelbl, Frankfurt am Main 1989.
- Gerhard Lampe: Ich will mich erinnern an alles was man vergißt: Erich Fried – Biographie u. Werk. Bund-Verlag, Köln 1989, ISBN 3-7663-3092-6 (vergriffen). Neuauflage: Fischer digital Verlag, Frankfurt/M. 2016, ISBN 978-3-596-30897-2.
- Joseph A. Kruse (Heinrich-Heine-Institut) (Hrsg.): Einer singt aus der Zeit gegen die Zeit: Erich Fried 1921–1988: Materialien und Texte zu Leben und Werk. Häusser, Darmstadt 1991, ISBN 3-927902-50-0.
- Volker Kaukoreit: Frühe Stationen des Lyrikers Erich Fried. Darmstadt 1991.
- Catherine Fried-Boswell, Volker Kaukoreit (Hrsg.): Erich Fried. Ein Leben in Bildern und Geschichten. Wagenbach, Berlin 1993, ISBN 3-8031-3585-0.
- S. W. Lawrie: Erich Fried. A Writer Without A Country. New York 1996.
- Interpretationen. Gedichte von Erich Fried. Hrsg. von V. Kaukoreit, Stuttgart 1999.
- Jörg Thunecke: Erich Fried. In: Andreas B. Kilcher (Hrsg.): Metzler Lexikon der deutsch-jüdischen Literatur. Jüdische Autorinnen und Autoren deutscher Sprache von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Metzler, Stuttgart/Weimar 2000, ISBN 3-476-01682-X.
- Tilman von Brand: Öffentliche Kontroversen um Erich Fried. Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2003, ISBN 3-936846-20-0.
- Catherine Fried: Über kurz oder lang. Erinnerungen an Erich Fried. Übersetzt von Eike Schönfeldt, Fotos von Catherine Fried. Wagenbach, Berlin 2008, ISBN 978-3-8031-1257-6.
- Erich Fried – Heiner Müller. Ein Gespräch. Alexander Verlag, Berlin 1989, ISBN 3-923854-49-8.
- Sonja Frank (Hrsg.): Young Austria. ÖsterreicherInnen im Britischen Exil 1938 bis 1947. Für ein freies, demokratisches und unabhängiges Österreich. 2. erweiterte Auflage mit DVD. Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, Wien 2014, ISBN 978-3-901602-55-9.
- Thomas Wagner: Der Dichter und der Neonazi: Erich Fried und Michael Kühnen – eine deutsche Freundschaft. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 978-3-608-98357-9.
- Moshe Zuckermann, Susann Witt-Stahl: Gegen Entfremdung, Lyriker der Emanzipation und streitbarer Intellektueller. Gespräche über Erich Fried, Frankfurt 2018/21, ISBN 978-3-86489-825-9.
Vertonungen
- Reinhard Fehling (1993): „FriedFarben“ – ein Liederzyklus für Instrumente, Solostimmen und Vokalensemble. (enthält u. a.: Was es ist, Die Maßnahmen, Du liebe Zeit), CD erhältlich beim Komponisten.
- Paul Kalkbrenner (2001): Vertonung von Krank auf dem Album „Superimpose“
- 2007 vertonte der deutsche Polit-Rapper Chaoze One das Gedicht Fall ins Wort auf seinem Album Fame.
- Umstritten ist die Vertonung des Gedichtes Was es ist durch die Band „MIA.“
- Friedemann Holst-Solbach (2010): Leid unverstanden. (Vertonte Gedichte von Erich Fried, Carl Albert Lange und Ingeborg Drews, für mittlere Stimme und mittelschwere Gitarrenbegleitung, mit CD – enthält u. a.: Rückzug; Die Türe; Herbst; Die Fragen und die Antworten; Höre, Israel; Fortschritt; Berufswahl – ISMN 9-790-50075-012-3)
- Günther Wiesemann: "Was ist Leben/Zündtemperatur" nach Erich Fried-Gedichten (1985), für Mezzosopran, Gitarre, Fagott, Cembalo und Klavier (Uraufführung 1985 in Wuppertal). Livezusammenarbeit als Pianist gemeinsam mit dem Trompeter Dietmar Hippler mit Erich Fried von 1981 bis 1986.
- Der Komponist und Musiker Jochen Micha hat in den letzten zehn Jahren etliche Gedichte von Erich Fried für Gesang, Klavier, Kontrabass und Gitarre vertont. Regelmäßig werden von ihm und seiner Pianistin Ziva Melisa Erich-Fried-Abende veranstaltet. Das Duo Metronomicha hat eine CD (EAN 4 260069 346235) mit dem Titel "Erich Fried – nicht nur Liebesgedichte" mit 15 Vertonungen veröffentlicht.[18]
- Beate Himmelstoss und Jürgen Jung sprechen: Höre Israel, Gedichte und Fußnoten, gegenüber der Buchausgabe leicht gekürzt, neu geordnet und mit zusätzlichen Anmerkungen versehen, Musik Baher al-Regeb (Qanoun) und Ghidian Qaimari (Oud), 2 CD mit Booklet, 2010, ISBN 978-3-9813189-9-9.
- Martin Christoph Redel: "WAS ES IST. Lyrisches Traumbuch für Bariton und Klavier op. 54 (2001). Uraufführung am 13. Mai 2003 Wien. Thomas Quasthoff, Bariton; Justus Zeyen, Klavier. Verlag Edition Gravis, Brühl/Berlin 2005. ISMN M-2057-0682-1
- h. c. mylla: "... und alle seine Mörder", Singspiel in zwei Aufzügen, Uraufführung am 19. Jänner 1995 in München
Filme
- 1986: Erich Fried – Der Dichter in seinem Widerspruch (Film von Christian Feyerabend und Gerhard Lampe, WDR)
- 1986: Gespräche mit Erich Fried (Film von Joern Schlund und Gottfried Kühnel)
- 1988: Exiles: Erich Fried, Austrian Poet (London, BBC TV)
- 1988: Die ganze Welt soll bleiben. Erich Fried / Ein Porträt
- 1995: Was bleibt … Eine Erinnerung an Erich Fried (Ein Film von Roland Steiner)
- 2021: Wir sind ein Ton aus Tun. Zum 100. Geburtstag von Erich Fried (TV-Doku von Danielle Proskar)
Weblinks
- Literatur von und über Erich Fried im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Werke von und über Erich Fried in der Deutschen Digitalen Bibliothek
- Erich Fried im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek
- Erich Fried | Der literarische Arbeiter: Die offizielle Webseite zu Erich Fried. Erstellt und betreut durch den Verlag Klaus Wagenbach.
- Erich Fried Bibliographie der Internationalen Erich Fried Gesellschaft für Literatur und Sprache (Wien) (PDF; 2,6 MB)
- Eintrag zu Erich Fried im Austria-Forum (im AEIOU-Österreich-Lexikon)
- Erich Fried. Eine Autorenwebsite von Inga Janzen: Eine private Webseite mit Informationen zu Erich Fried und einem Link-Verzeichnis zu Fried-Gedichten im Netz
- Erich Fried – Ein gebrauchter Dichter: Textcollage des Journalisten Detlef Berentzen zum 15. Todestag von Erich Fried 2003
- Erich Fried im Online-Archiv der Österreichischen Mediathek (Lesungen, Tagungen und Radiobeiträge)
- Audiomitschnitt: Erich Fried im Gespräch mit Walter Höllerer, Lesung politischer Gedichte (September 1986), zum Anhören und Downloaden auf Lesungen.net
- Tilman von Brand: Fried, Erich und von der Osten, Heike, in: Kurt Groenewold, Alexander Ignor, Arnd Koch (Hrsg.): Lexikon der Politischen Strafprozesse, Online, Stand Januar 2017.
- Erich Fried in der Internet Movie Database (englisch)
- https://srv.deutschlandradio.de/dlf-audiothek-audio-teilen.3265.de.html?mdm:audio_id=759474
Einzelnachweise
- Catherine Fried: Über kurz oder lang. Klaus Wagenbach, Berlin 2008, ISBN 978-3-8031-1257-6, S. 71.
- https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/rudi-dutschkes-freunde-und-helfer-1214993.html
- Catherine Fried: Über kurz oder lang. Klaus Wagenbach, Berlin 2008, S. 59.
- Jürgen Doll: « Die Furcht des Flüchtlings vor der Heimkehr » Erich Fried in England. In: CAIRN.INF0. Études Germaniques 2008/4 (n° 252), pages 877 à 887, 2008, abgerufen am 11. Mai 2021 (deutsch).
- Helmut Böttiger: Politik und Liebe. Jüdische Allgemeine, 2. Mai 2021, abgerufen am 22. August 2022.
- Sandra Beck: „Totenklage über ein so gelebtes Leben“, in: Lyrik im historischen Kontext. Festschrift für Reiner Wild. Königshausen & Neumann, Würzburg 2009, S. 413.
- Rundschau – Das Blut der Anderen. Abgerufen am 6. Februar 2018.
- Ich, Kühnen – Deutschlands gefürchtetster Nazi erklärt sich. Abgerufen am 6. Februar 2018.
- Tabubruch bei "Vanity Fair": Der Nazi, der Jude und das Prinzip Eitelkeit. In: Spiegel Online. 4. November 2007 (spiegel.de [abgerufen am 6. Februar 2018]).
- Einstweilen alles Liebe! Dein Erich, in Die Zeit (Wochenzeitung), Hamburg, Nr. 6, 4. Februar 2021, S. 49
- Fritz J. Raddatz: „Die die Wege an ihren Zielen messen die irren“: Und immer aufrechten Ganges Zum Tod des Dichters Erich Fried. Die Zeit, 2. Dezember 1988, abgerufen am 4. Mai 2017.
- Dror Dayan: Antizionismus war Teil seiner antifaschistischen Identität (Interview mit Klaus Fried). In junge Welt vom 30. April 2021, Seite 1 (Beilage), abgerufen am 4. Mai 2021.
- Profil von Klaus Fried auf der Internetseite des London College of Communication (englisch), abgerufen am 4. Mai 2021.
- Wien – Literaturhaus Wien, Veranstalter: Erich Fried Gesellschaft, 7. Nov. 2008
Aachen – Buchhandlung Schmetz, 11. Nov. 2008
Freiburg – Buchhandlung Schwanhäuser, 12. Nov. 2008
Berlin – Bibliothek im Wasserturm, Veranstalter: Sebastian Haffner Institut, 14. Nov. 2008
Recklinghausen – Kunsthaus Recklinghausen, Veranstalter: Neue Literarische Gesellschaft Recklinghausen, 23. Nov. 2008
Bad Boll – Evangelische Akademie Bad Boll, 6. Dez. 2008
London – Österreichische Botschaft London, 9. Dez. 2008. - http://www.brg9.at/web/und/http://erich-fried-gesamtschule.de/
- Das Buch wurde erst 1960 publiziert, obschon es bereits 1946 geschrieben war. Vgl. Biografie
- Fried selbst klassifizierte das Werk allerdings nie als ‚Roman‘. Vgl. Lindemann, Gisela: „Ilse Aichinger“, Beck: München 1998, S. 20: „Erich Frieds […] einzigem Roman ‚Ein Soldat und ein Mädchen‘ (den übrigens nur der Verlag einen Roman nannte, nicht der Autor)“.
- Jochen Micha
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Fried, Erich |
| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Lyriker, Übersetzer und Essayist |
| GEBURTSDATUM | 6. Mai 1921 |
| GEBURTSORT | Wien |
| STERBEDATUM | 22. November 1988 |
| STERBEORT | Baden-Baden |
На других языках
- [de] Erich Fried
[en] Erich Fried
Erich Fried (6 May 1921 – 22 November 1988) was an Austrian-born poet, writer, and translator. He initially became known to a broader public in both Germany and Austria for his political poetry, and later for his love poems. As a writer, he mostly wrote plays and short novels. He also translated works by different English writers from English into German, most notably works by William Shakespeare.[es] Erich Fried
Erich Fried (Viena (Austria), 6 de mayo de 1921 - Baden-Baden (Alemania), 22 de noviembre de 1988) fue un poeta austriaco, quien vivió gran parte de su vida en Inglaterra. También trabajó como presentador, traductor y ensayista.[fr] Erich Fried
Erich Fried, né le 6 mai 1921 à Vienne et mort le 22 novembre 1988 à Baden-Baden, est un poète, traducteur et essayiste autrichien juif, établi en Angleterre au Royaume-Uni.[ru] Фрид, Эрих
Эрих Фрид (нем. Erich Fried; 6 мая 1921 (1921-05-06), Вена, Австрия, — 22 ноября 1988, Баден-Баден, ФРГ) — австро-британский писатель, поэт, журналист и радиоведущий.Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии